13.05.2019
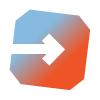 MoVE
MoVE
Im Projekt MoVE wird die erste modulare Test- und Validierungsplattform für offen vernetzte Medizingeräte entwickelt. Die angestrebte Plattform unterstützt die Hersteller von Medizintechnik bei der Entwicklung und der Zulassung von Medizingeräten, die eine offene Vernetzung auf Basis der neuen IEEE 11073 SDC Standardfamilie realisieren. (mehr lesen)
21.06.2017
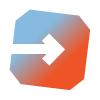 AutoSON
AutoSON
Ziel des Projektes AutoSon ist die Entwicklung eines vernetzen Assistenzsystems zur Unterstützung neurochirurgischer Eingriffe. Das AutoSon-System besteht aus einem erweiterten, neurochirurgischen Navigationssystem sowie einer Forschungsplattform, die über offene Schnittstellen während der Planung, Durchführung und Dokumentation der Operation interagieren. (mehr lesen)
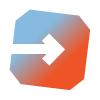 EMU
EMU
Es wird ein multimodales Beatmungssystem mit kombinierter EIT – Messvorrichtung entwickelt, das für eine temporäre Überwachung und automatisierte Beatmung des Patienten eingesetzt werden kann. Dabei sollen Vitalparameter wie z.B. Lungenaktivität und -volumen erfasst werden. Zusätzlich integriert ein Brustgurt eine Bildgebung des Thorax bzw. der Lunge, welche auf EIT basiert. (mehr lesen)
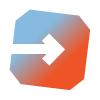 EU-MFH
EU-MFH
The aim of this international project is to substantially improve medical care during European disaster relief missions. The various EU Member States are contributing their specific expertise in order to develop a mobile emergency field hospital which can be quickly set up and used to treat a large number of patients from first response to hospital care. (mehr lesen)
06.10.2020
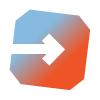 DIRTH
DIRTH
Projektbeschreibung
Bei der Infrarotthermografie wird elektromagnetische Strahlung, die das menschliche Auge nicht sehen kann, von einem (warmen) Objekt gemessen. Sensoren in der Wärmebildkamera konvertieren die emittierten und reflektierten Strahlungen in grafische Bilder, in denen die Bildintensitäten proportional zu den Körpertemperaturen dargestellt sind. Dieses Verfahren ist nichtinvasiv, kontaktlos und einfach in der Anwendung. Der Anwendungsbereich von Thermografie in der Medizin ist breit: Untersuchung bei Kreislaufstörungen und Gelenkentzündungen, Detektion von Tumoren oder Untersuchung der Durchblutung von Gewebe. Da dieses Verfahren keinen Kontakt mit dem Patienten erfordert, sind Wärmebildkameras besonderes für den Einsatz in der Chirurgie geeignet.
Hersteller bieten derzeit eine große Auswahl an Wärmebildkameras an, die für die Anwendung im OP-Saal jedoch nicht optimal geeignet sind. Die Anforderungen sind: die Aufnahme eines kleinen Bereiches in einem Bild mit maximaler Anzahl von Pixeln, die Detektion von minimalen Temperaturunterschieden, die Kompatibilität des Systems mit der OP-Umgebung (Größe, Mobilität, Bedienfreundlichkeit). Außerdem wird die Aufnahme und Darstellung der Bilder von Software gesteuert, die nur einfache Werkzeuge für die Auswertung der Wärmebilder anbietet. Für eine genauere Auswertung der Wärmebilder, besonderes bei der dynamischen Thermografie, soll die Software verbessert und ergänzt werden.
Die Entwicklung eines DIRTH-Systems (Dynamisches InfraRotTHermografiebildgebungs-System) soll die Verwendung der Thermografie im OP-Saal erleichtern und die Interpretation bzw. die Auswertung der thermischen Bilder verbessern.
Forschungsziele
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines leichten und portablen Infrarotthermografiegerätes für den Einsatz im OP-Saal. Das System muss kompakt und transportabel sein, damit es einfach in verschiedenen OP-Sälen eingesetzt werden kann. Das zu entwickelnde System wird mit leistungsfähigen Softwarealgorithmen für eine optimale Visualisierung und Auswertung der thermischen Bilder bei statischer und dynamischer Thermografie ausgestattet. Abschließend erfolgt eine Evaluierung des DIRTH-Systems und seiner Funktionen mit den klinischen Partnern im OP-Saal.
Thematische Schwerpunkte
- Entwicklung eines neuen, kompakten und transportablen Systems für dynamische Thermografiebildgebung
- Entwicklung von neuen Funktionen für die Auswertung dynamischer Thermografie
- Evaluation bei plastischer Chirurgie
15.04.2019
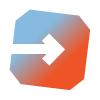 DPM
DPM
Im Projekt werden informationstheoretische Konzepte zur formalen Beschreibung und Modellierung von Patientendaten und von chirurgischen Entscheidungsprozessen erstellt. Patientenmodelle verknüpfen und analysieren sämtliche für eine Operation und Therapieplanung relevante Daten und ermöglichen somit eine Rundumdarstellung des Patienten sowie seines erkrankten Organs. Entscheidungsmodelle beschreiben die Entscheidungsprozesse. (mehr lesen)
21.06.2017
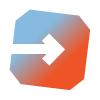 Dental Imaging
Dental Imaging
Das Hauptziel von Zahnbehandlungen ist die Mundgesundheit sowie der Erhalt der Zahnstrukturen. Hierzu ist ein modernes Kariesmanagement (Prophylaxe) erforderlich, welches alle Verfahren zur Verhinderung neuer kariöser Läsionen (Defekte) umfasst. Ebenso wichtig ist die Erkennung und Beurteilung von frühen kariösen Läsionen und die Überwachung von direkten und indirekten Restaurationen (Zahnwiederherstellungs-Bonding). Das nichtinvasive bildgebende OCT ist ein geeigneter Ansatz zur Darstellung harter Zahnstrukturen bis zu einer Tiefe von 2,5 mm. Frühere Studien zeigten, dass der Nachweis kariöser Läsionen und die Beurteilung des Zahn-Komposit-Verbunds vielversprechende Anwendungsgebiete des OCT zur Zahnerhaltung sind.
Publikationen
Schneider H, Park KJ, Häfer M, Rüger C, Schmalz G, Krause F, Schmidt J, Ziebolz D and Haak R. Dental Applications of Optical Coherence Tomography (OCT) in Cariology. Appl. Sci. 2017; 7(5): 472-493
Park KJ, Schneider H, Haak R. Assessment of interfacial defects at composite restorations by swept source optical coherence tomography. J Biomed Opt. 2013; 18(7):076018
Park KJ, Schneider H, Haak R. Assessment of defects at tooth/self-adhering flowable composite interface using swept-source optical coherence tomography (SS-OCT). Dent Mater. 2015; 31(5):534-41
Häfer M, Jentsch H, Haak R, Schneider H. A three-year clinical evaluation of a one-step self-etch and a two-step etch-and-rinse adhesive in non-carious cervical lesions. J Dent. 2015; 43(3):350-61
Schneider H, Krause F, Ziebolz D, Haak R. Optische Kohärenztomographie in der Kariesdiagnostik und Restaurationsbeurteilung. Quintessenz 2016; 67(7): 869-879
Schneider H, Park KJ, Rueger C, Ziebolz D, Krause F, Haak R. Imaging resin infiltration into non-cavitated carious lesions by optical coherence tomography. J Dent. 2017; 60:94-98
Park KJ, Haak R, Ziebolz D, Krause F, Schneider H. OCT assessment of non-cavitated occlusal carious lesions by variation of incidence angle of probe light and refractive index matching. J Dent. 2017; 62:31-35
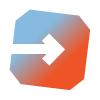 BIOPASS
BIOPASS
Das Projekt BIOPASS befasst sich mit der Entwicklung eines neuartigen Navigationsverfahrens für die endoskop-geführte minimal-invasive Chirurgie. Ziel ist es, endoskopische Informationen mit denen des OP-Ablaufs zu kombinieren und in für eine Software lernbaren Situationen zu beschreiben. Die dadurch erzielte Intelligenz der Software soll dem Chirurgen bei seiner Arbeit helfen und gleichzeitig Hardware-bedingte Anforderungen und Fehlereinflüsse verringern. Im zweiten Projektjahr wurden die identifizierten klinischen und technischen Anforderungen genutzt, um erste Funktionen für das BIOPASS-System umzusetzen. Ein erster Prototyp wurde am ICCAS entwickelt, um speziell die Interaktion zwischen Anwender und intelligenter Software am Beispiel eines HNO-Eingriffs zu simulieren. Ein wesentlicher Fokus liegt dabei auf den präsentierten Informationen und der Navigation durch die anatomischen Regionen in der Endoskopsicht. In weiterführenden Arbeiten wird ein erster Demonstrator am ICCAS entwickelt, der die einzelnen Funktionen der Projektpartner zusammenführt.




